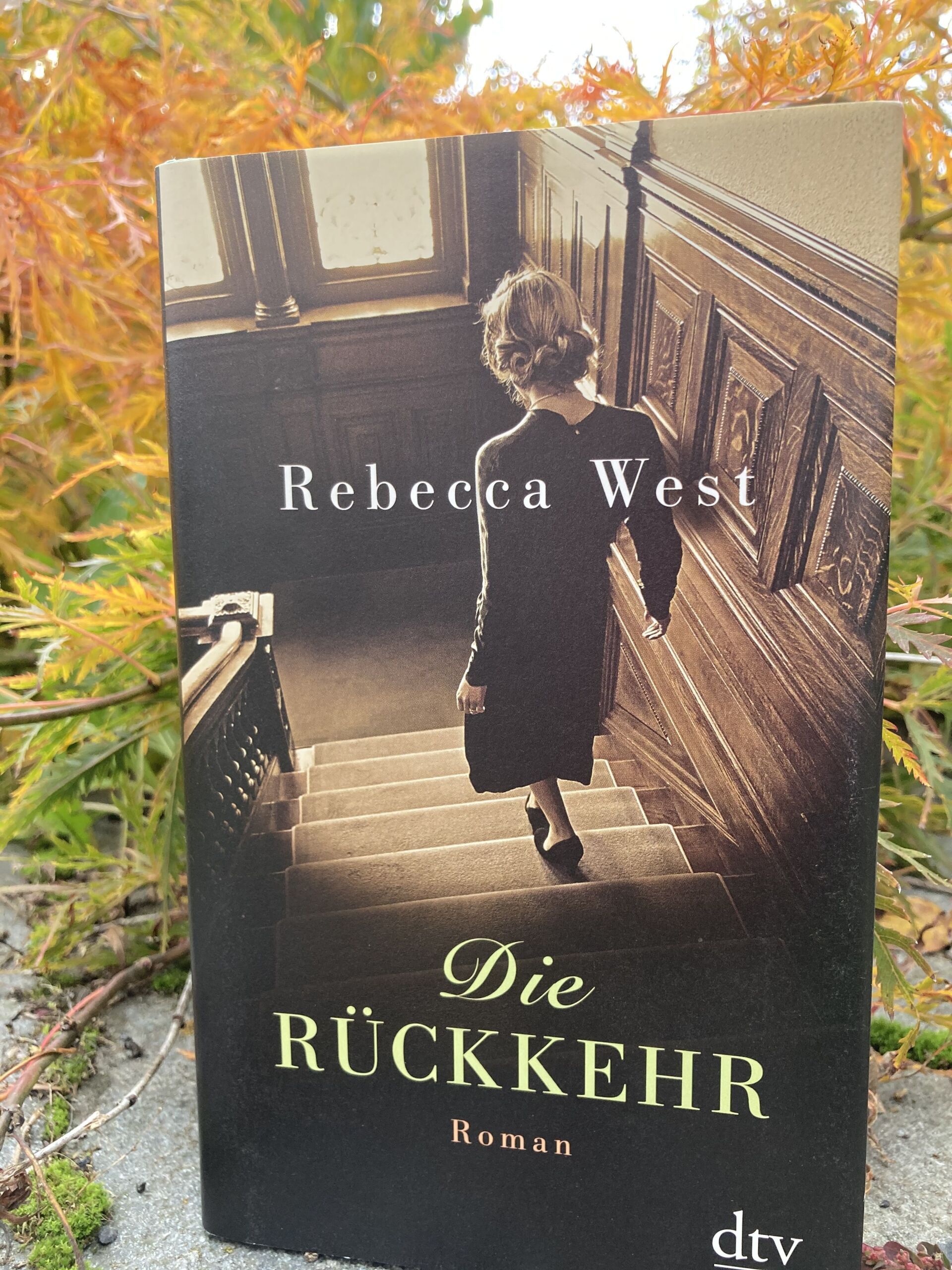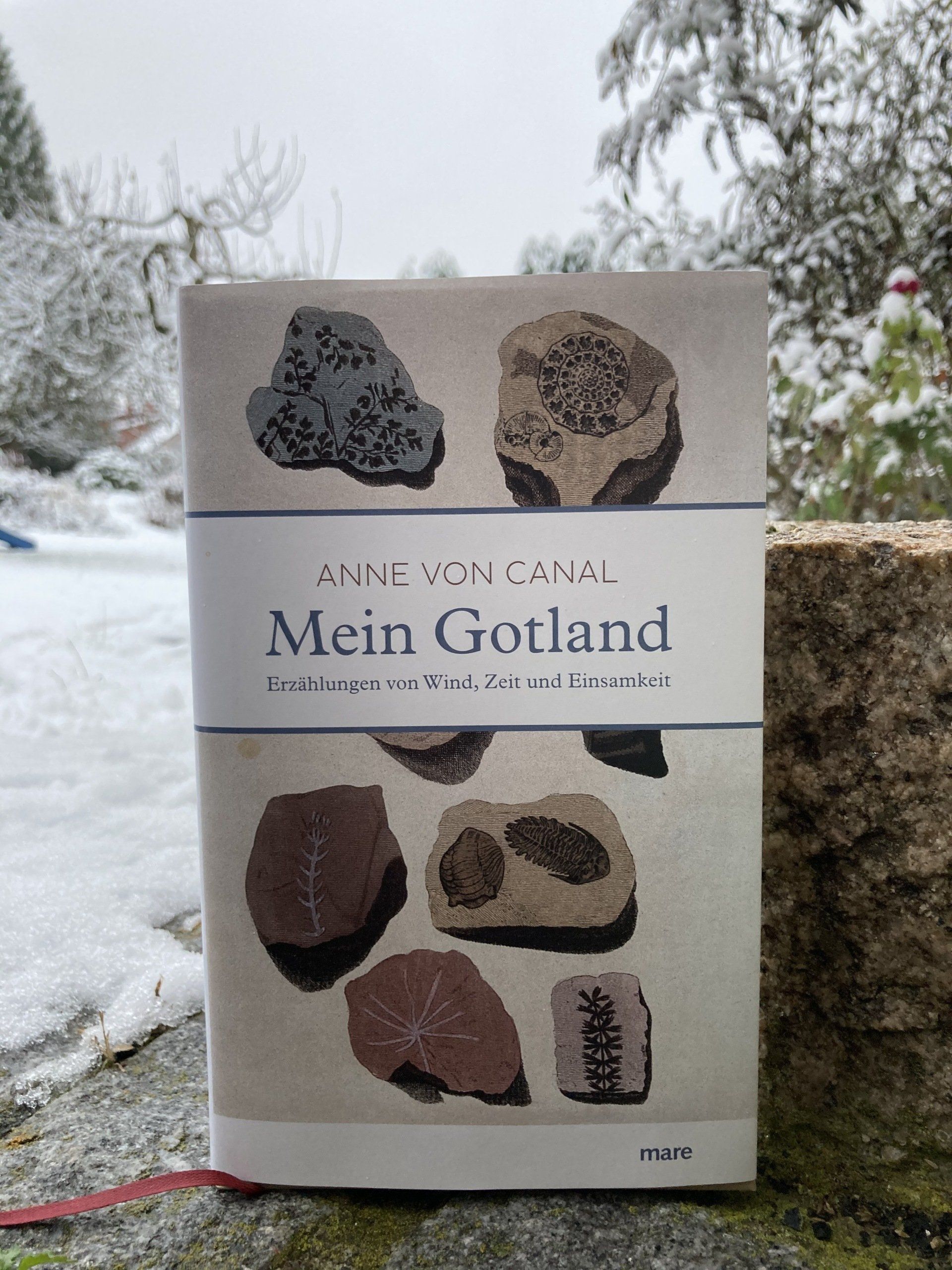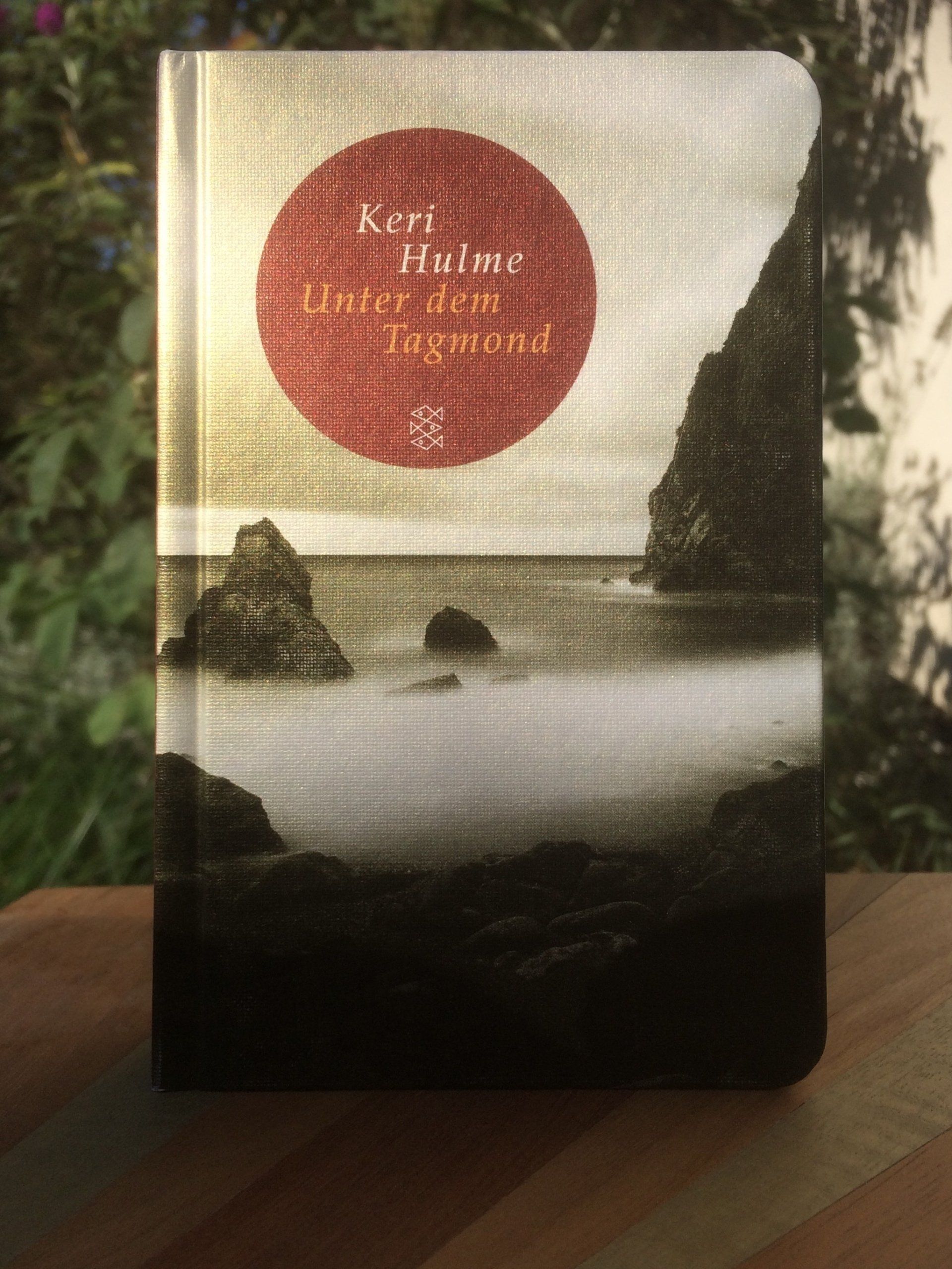Und da halte ich es in der Hand: Ein schmales Bändchen aus dem verehrungswürdigen Verlag dtv, darauf zu sehen eine Frau von hinten, wie sie die Treppe herabsteigt, die Haare umkränzt vom feinen Gegenlicht. Alles an diesem Bild, die Farbe, die Kleidung, die Haltung, die Vertäfelung der Wände, verrät mir, dass diese Szene eine Szene aus den 20er Jahren sein muss.
Damit liege ich nicht ganz falsch. Rebecca Wests Roman „Die Rückkehr“ erschien zum ersten Mal 1918 und gilt als einziger Roman einer Frau dieser Zeit, die den ersten Weltkrieg thematisiert.
Kitty und ihre Cousine Jenny sind zwei junge Frauen der gehobenen Mittelschicht im Englischen Süden. Sie bewohnen zusammen ein Herrenhaus. Beide warten darauf, dass Kittys Ehemann Chris wohlbehalten aus dem Krieg zurückkehrt und damit ihr wohlgeordnetes Leben wieder einziehen kann.
Doch Chris kommt nicht wohlbehalten zurück. Er hat bei einem Angriff durch eine Granate sein Gedächtnis verloren und erinnert sich nicht mehr an seine Ehefrau, nicht an Jenny, nicht an das prachtvolle Haus, dafür aber an seine erste große Liebe Margaret.
Margaret wird in das Haus eingeladen, um Chris zu heilen, und ab da verwirren sich die Geschehnisse zu einem Gespinst aus Eifersucht und Drama. Mit welcher Leichtigkeit und wie fast nebenbei Rebecca West in dieser Gemengelage die großen menschlichen Fragen stellt, zeugt von großer Meisterschaft. Was tut der Mensch nicht alles, um dem drohenden Chaos zu begegnen? Und wie wichtig ist die Wahrheit, um seine Würde als Mensch bewahren zu können? Und so treffen zwei der drei Frauen am Ende eine wagemutige Entscheidung. Sehr großes Kino!
Alte Texte wie dieser üben einen magischen Sog auf mich aus. Diese Empfindsamkeiten und Naturbetrachtungen sind den meinen so ähnlich. Und das bedeutet nichts weiter, als dass, egal welche Sprache wir gebrauchen und welche Spielzeuge uns gefallen, diese Gefühlswelten im Menschen universell sind. Da blühen Pflanzen und vergehen, manches ist wild, anderes gezähmt, um unser Auge zu erfreuen und uns vor der Erkenntnis zu bewahren, dass wir sterblich sind. Immer wirkt die gleiche Antriebsfeder, das Bedürfnis, gegen das Vergessen und Vergehen etwas zu unternehmen. Überall wo der Mensch seiner Umwelt ästhetischen Zwang antut, Worte in Prosa oder Verse fasst, Lieder schreibt, einen Garten anlegt oder versucht, von seiner Umgebung mit Pinsel und Farbe oder einem Fotoapparat ein erträgliches Abbild zu schaffen, ringt er mit der Vergänglichkeit. Und das schon seit Menschen Gedenken.
Wie nebenbei fließen dann Dinge ein, die es so nicht mehr gibt, die man aus der Distanz gerade eben so erkennt, das knatternde Geräusch von Zeppelinen, die über den Himmel fahren, das Klackern billiger Korsettstäbchen, die Tatsache, dass der Chauffeur aussteigen muss, um den Motor des Wagens anzulassen, verschwommen taucht in uns das Bild einer Kurbel auf, die es so seit ewiger Zeit nicht mehr gibt.
Unsere Geräusche sind vielleicht andere, Zeppeline gibt es nicht mehr, auch nicht die Antriebskurbel am Kühler eines Autos. In Zukunft werden Autos nicht nur keine Geräusche mehr machen, sondern auch noch selber fahren. Die Menschen in diesem Roman sind schon seit geraumer Zeit tot, genauso wie ihre Autorin. Aber ihre moralischen Überlegungen, ihre Eifersucht und ihre Kriege, ihre Liebe und ihre Hingabe waren zu allen Zeiten die gleichen wie unsere. Und sie waren, wie unsere, immer modern. Mit Ehrfurcht und Zittern erkenne ich darin meine eigene Vergänglichkeit und klappe das Buch zu mit dem Gefühl, in einen tiefen Brunnen geschaut zu haben.