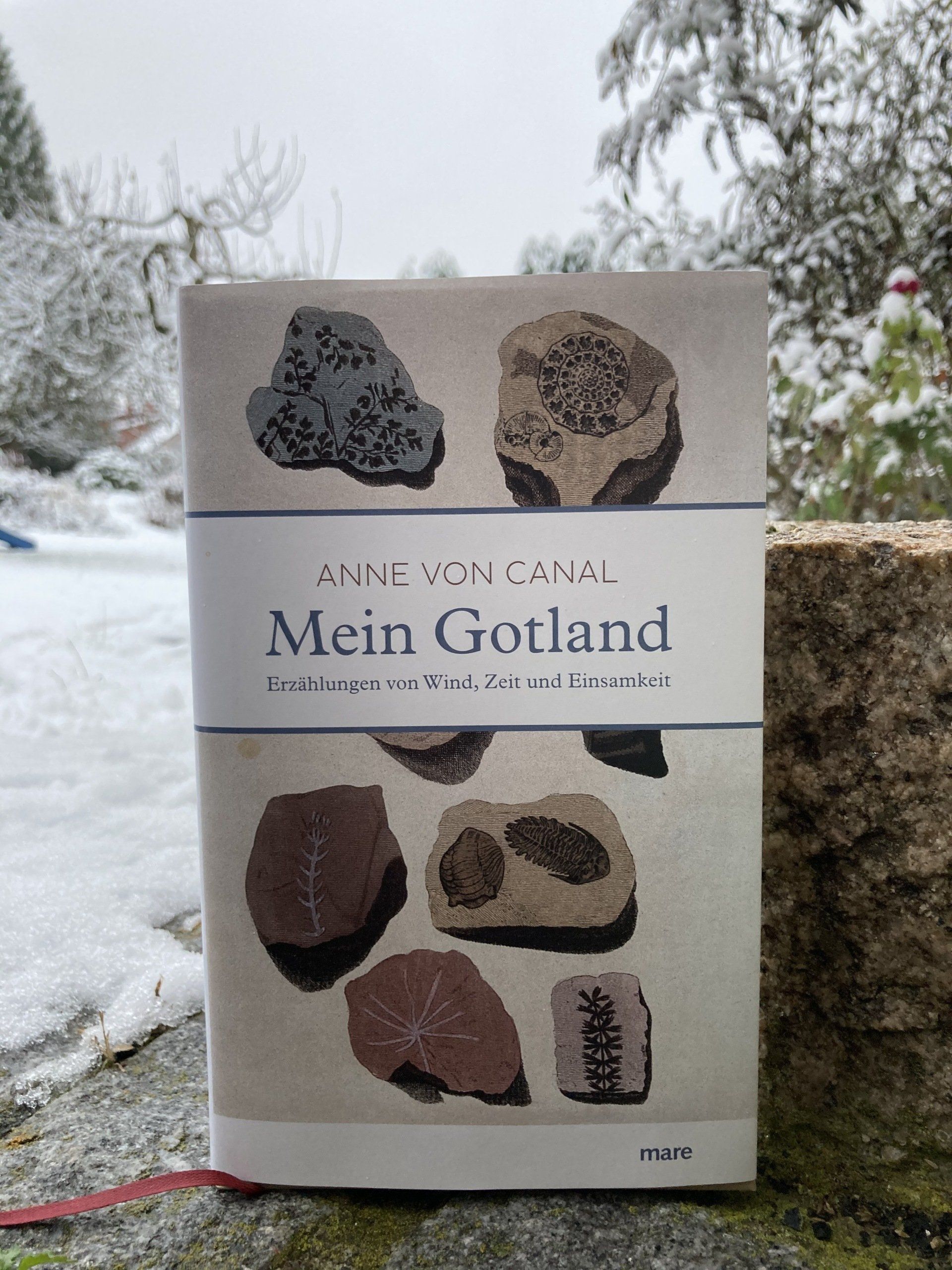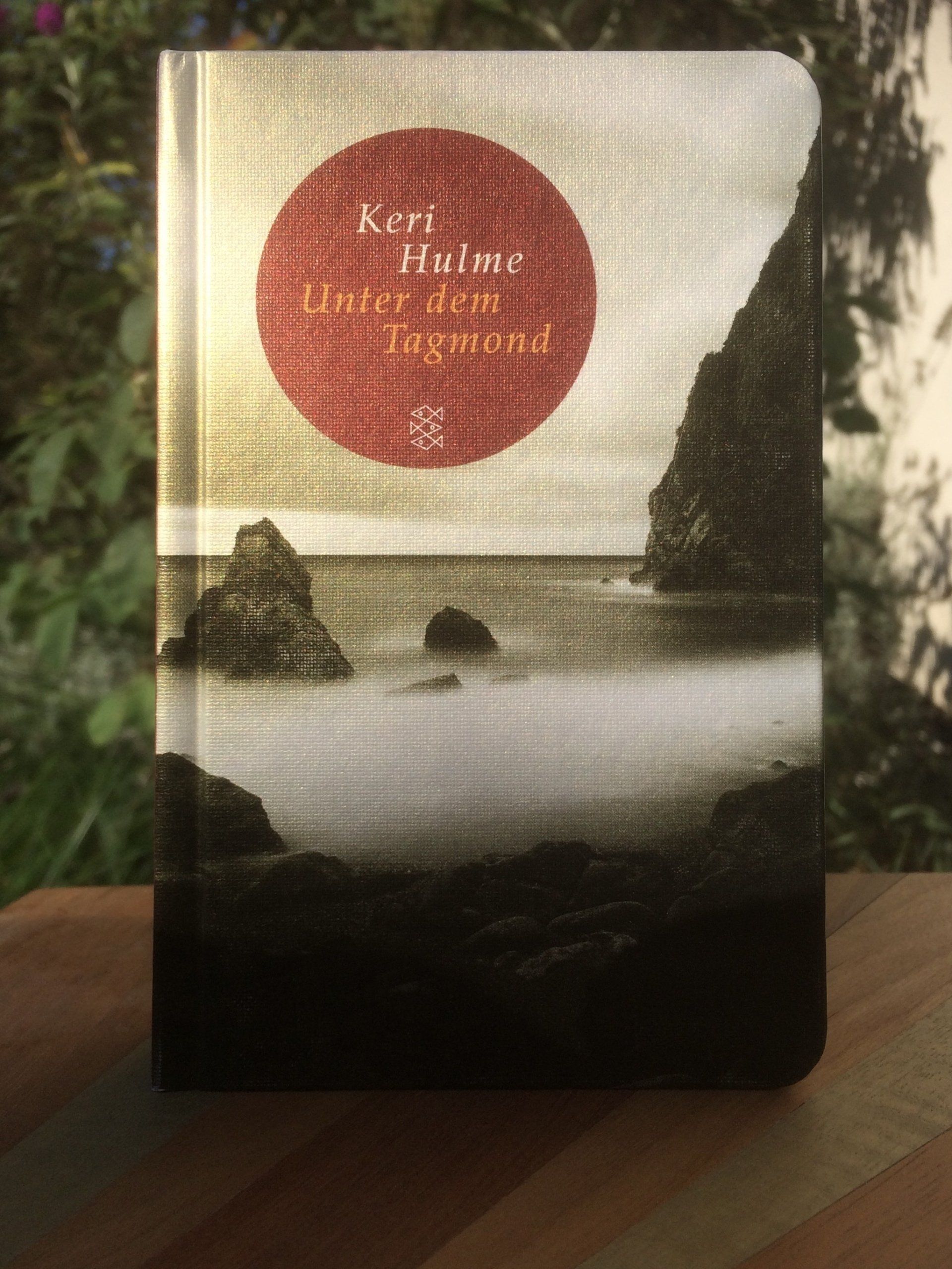Ein Wunderwerk aus Japan. „Insel der verlorenen Erinnerungen“ erschien dort schon im Jahr 1994. Jetzt hat der Liebeskind Verlag eine deutsche Übersetzung von Sabine Mangold vorgelegt. Im Liebeskind Verlag mag man es gerne etwas düster, gerne Geschichten aus entlegenen Landstrichen, in denen die Einsamkeit beinahe selbst eine Hauptfigur ist. Warum also nicht einmal eine Insel?
Eigentlich weiß niemand auf der Insel, was zuerst verschwand. Dinge verschwinden schon so lange und nichts davon hinterlässt einen Widerhall, eine Erinnerung. Mit dem Verschwinden der Dinge lösen sich bei den Menschen auch die Erinnerungen an ihre Bedeutung in einer Art Nebel auf.
Auf der Insel lebt eine namenlose Ich-Erzählerin. Sie ist Schriftstellerin und hat ein paar erfolgreiche Romane geschrieben. Als sie noch ein Kind war, hat ihre Mutter ihr gerne Dinge gezeigt, die eigentlich schon längst verschwunden waren. Sie bewahrte sie in einer geheimen Schublade auf und holte sie hin und wieder heraus, um sie ihrer Tochter zu zeigen. Ein Flacon mit Parfum, ein kleines Glöckchen. Wie gut das duftete, wie hübsch das klang.
Diese fast schon intimen kleinen Ereignisse am Anfang des Romans sind bereits von großer, poetischer Kraft und erzeugen beim Lesen das wohlige Gefühl, sich auf eine märchenhafte Geschichte einzulassen, die einen schützt und wärmt und die langen Winternächte vertreibt. Wenn man doch nur schon am Anfang wüsste!
Wieder verschwinden Dinge, zuerst die Vögel. Jeder Inselbewohner bringt seine Vögel in ihren Käfigen zum Fluss und lässt sie fliegen. Im gleichen Moment weiß niemand mehr, wie das Singen der Nachtigall einem das Herz hat höher schlagen lassen.
Es vergeht immer etwas Zeit. Und wieder verschwindet so einiges. Irgendwann sind es die Rosen. Bei dem Bild, das Ogawa für diesen Vorgang heraufbeschwört, sieht man Massen von Rosenblättern im Fluss Richtung Meer treiben. Irgendwie schafft sie es, dass diese Blütenblätter lebendig wirken, wie kleine, hilflose Tiere, die sich am Ufer festkrallen wollen, die bleiben, die nicht ausgelöscht werden wollen. Ein Schauspiel, dem die Bewohner ungerührt beiwohnen.
Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass dies hier eine bitterböse Geschichte ist. Es zerreißt einem schon jetzt schier das Herz. Auf leisen Sohlen hat sich das Grauen eingeschlichen, nicht das Grauen der Monster und Schreckgespenster, sondern das Grauen einer gefühllosen Welt.
Vielleicht spielt Ogawas Interesse für Anne Frank bei diesem Buch eine Rolle. Dieses quälende Unbeteiligtsein der Umstehenden, wenn mal wieder etwas aus ihrem Leben verschwindet, das ihnen eben noch teuer war. Sicherlich stand auch der Roman 1984 von George Orwell Pate. Das Beklemmende eines Überwachungsstaates ist körperlich spürbar.
Aber Hoffnung gibt es doch. Ein paar einzelne Menschen sind mit der Fähigkeit zu Erinnern ausgestattet. Der Lektor der Icherzählerin zum Beispiel ist einer von ihnen. Als Die Erinnerungspolizei aber anfängt, Leute zu verhaften, ist er in Gefahr und wird von der Erzählerin und einem alten Freund der Familie versteckt. Eine der schönsten Szenen in diesem Buch ist die Geburtstagsfeier für den alten Freund, die von der Außenwelt unbemerkt stattfinden muss. Hauchfeinste Poesie der schönsten Sorte. Es stellen sich einem die Nackenhaare zu Berge, als man draußen Stiefel vernimmt.
In der Hauptgeschichte verbirgt sich wie eine Matroschka noch eine zweite Geschichte. Der aktuelle Roman, den die Protagonistin schreibt, handelt von einer Frau, die sich in den Lehrer ihres Schreibmaschinenkurses verliebt. Dass diese Geschichte nicht gut ausgeht, versteht sich von selbst.
Dieses Buch ist ein dunkles Kleinod. Ogawa schreibt Prosa wie schimmerndes Porzellan, federleicht und zerbrechlich einerseits, doch gleichzeitig kann Hitze und Feuer ihm nichts anhaben. Ein kleiner, unglaublich eindringlicher Roman, der einen lange begleitet. Und auch wenn das Ende hinter jedem Buchstaben lauert, ist es ein unglaublicher literarischer Genuss.